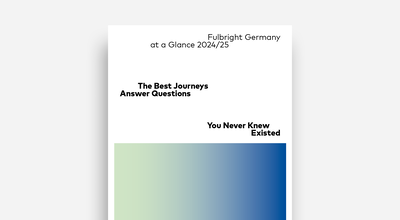Transatlantische Transformationen: Jacob Eder über prägende Erfahrungen im amerikanischen Heartland
Jacob Eder | Fulbright-Studienstipendiat 2005/2006

Vor zwanzig Jahren führte ihn ein Fulbright-Stipendium aus München nach Lincoln, Nebraska - heute ist Jacob Eder Professor für Geschichte mit einem Schwerpunkt auf Erinnerungskultur und transatlantischen Beziehungen. Im Rahmen des diesjährigen Frankly-Schwerpunkts „Transatlantic Transformation“ blickt er auf seine Zeit an der University of Nebraska-Lincoln zurück und erzählt, wie dieses prägende Jahr seinen akademischen Weg entscheidend beeinflusste.
Im Gespräch berichtet Eder, wie ihn das Leben im „Heartland“ der USA aus seiner Komfortzone holte, welche Rolle das Mentoring seines Gastgebers Alan E. Steinweis spielte – und warum ihm seither kein Kulturschock mehr etwas anhaben kann. Seine jüngste Rückkehr nach Nebraska wurde dabei zur persönlichen Zeitreise, bei der Erinnerungen auf aktuelle Herausforderungen im akademischen Austausch trafen. Ein Gespräch über Perspektivwechsel, Biografie und die bleibende Relevanz transatlantischer Verbindungen.

Welche prägende Erfahrung während deines Fulbright-Jahres in Nebraska hat deine berufliche Laufbahn aus heutiger Sicht am meisten beeinflusst?
Als ich in Nebraska ankam, war ich schon recht weit in meinem Studium der Geschichte und Amerikanistik fortgeschritten, aber noch unschlüssig, welche berufliche Laufbahn ich einschlagen würde. Eigentlich hat mich Journalismus genauso interessiert wie die Wissenschaft. Im Rückblick war es dann nicht eine einzelne Erfahrung, sondern das Fulbright-Jahr insgesamt sowie die Chancen, die sich direkt im Anschluss für mich ergeben haben, aufgrund derer ich mich für eine wissenschaftliche Laufbahn entschieden habe. Prägend war vor allem das exzellente Mentoring, das ich an der Uni in Lincoln genießen durfte. Mein Gastgeber Alan E. Steinweis hat mich auch sehr dabei unterstützt, dass ich von Nebraska aus direkt im Anschluss erst für ein Fellowship nach Washington, D.C. und dann weiter an die University of Pennsylvania für die Promotion ziehen konnte.
Inwiefern hat das Leben im „Heartland“ der USA damals deine Perspektive auf Deutschland und Europa verändert?
Ohne Fulbright hätte ich sicher nie im Leben einen Fuß auf nebraskanischen Boden gesetzt. Im Grunde wollten 90% meines Fulbright-Jahrgangs damals an die Columbia, 5% nach Harvard, 5% nach Berkeley. Ich übertreibe ein wenig, aber so in etwa war die Stimmung. Ich muss gestehen, dass ich anfangs auch recht schockiert von Lincoln, der Hauptstadt Nebraskas, war. Man ist dort wirklich „in the middle of nowhere”, aus München kommend war das schon ein starker Kontrast. Aber das gehört ja eben zu Fulbright: sich aus der sprichwörtlichen Komfortzone begeben, neugierig und offen sein, und ein tieferes Verständnis für die neue Umgebung entwickeln. Was meinen Blick auf Deutschland und Europa angeht, war für mich eigentlich damals die zentrale Erkenntnis, dass für die meisten US-Amerikaner*innen, die ich dort kennengelernt habe, Europa wirklich sehr weit weg und im Grunde nicht allzu relevant erschien. Das war die Zeit kurz nach der Wiederwahl von George W. Bush, über den in Deutschland ja alle nur den Kopf geschüttelt haben. In Nebraska habe ich begriffen, warum den meisten US-Amerikaner*innen „unsere” Meinung über ihre Politiker herzlich egal ist. Hier setzt man die politischen Prioritäten einfach anders.

Wie hast du dich gefühlt, als du nach 20 Jahren wieder in Nebraska warst? Gab es bestimmte Orte oder Momente, die starke Erinnerungen geweckt haben?
Ich habe mich zunächst vor allem sehr gefreut, dass ich nach so vielen Jahren die Gelegenheit hatte, wieder nach Nebraska zu reisen. Auch wenn ich nur ein akademisches Jahr dort verbracht habe, war es biographisch schon ein sehr wichtiges Jahr für mich. An manchen Ecken des Campus in Lincoln hat sich einiges verändert, man sieht viele sehr moderne Gebäude, es gibt zum Beispiel auch ein ganz neues Stadion für die Basketballmanschaften, das auch als Konzertarena dient. Ein paar neue Coffee Shops habe ich auch entdeckt, in denen man sich eher wie in Brooklyn als im Mittleren Westen fühlt. Das gab es vor 20 Jahren nicht. Ansonsten hatte ich aber den Eindruck, dass in der Stadt die Zeit beinahe still gestanden ist. Um das Hauptgebäude des Campus herum oder an der großen Uni-Bibliothek hat sich so gut wie nichts verändert. Es fühlte sich also für mich auch ein wenig wie eine Zeitreise an, eine Reise zurück in die Vergangenheit.
Gab es Begegnungen mit ehemaligen Kommiliton:innen oder Professor:innen, die für dich besonders bedeutungsvoll waren?
Meine Gastgeber von vor 20 Jahren sind mittlerweile an andere Universitäten gewechselt, aber ich habe immerhin eine Professorin wiedergesehen, bei der ich 2005 mein erstes Seminar belegt hatte. Damals war sie ganz neu als Assistant Professor an die Uni gekommen, ich kann mich noch gut daran erinnern. Dass wir uns 20 Jahre später kollegial zum Abendessen treffen und über viele Jahre Unialltag reflektieren können, war wirklich sehr schön, auch wenn wir auf beiden Seiten des Atlantiks momentan mit großen Herausforderungen und Ungewissheiten konfrontiert sind.
Inwiefern hat deine Zeit in Nebraska dein inhaltliches Interesse/Ausrichtung beeinflusst, und siehst du Parallelen zwischen deiner damaligen und heutigen Tätigkeit?
Ich beschäftige mich bis heute intensiv mit dem, was man die „Nachgeschichte” des Holocaust nennen kann, in der Regel spricht man auch von Erinnerungskultur, Vergangenheitsbewältigung, Memorialisierung usw. Während meines Fulbright-Jahres in Nebraska habe ich mich vor allem mit amerikanischen Perspektiven auf dieses Themenfeld befasst. Alan E. Steinweis, mein Gastgeber, hatte kurz vor meiner Ankunft einen Aufsatz mit dem Titel „Reflections on the Holocaust from Nebraska” geschrieben, das fand ich wirklich hochinteressant, gerade als deutscher Geschichtsstudent. Warum sollte man überhaupt in Nebraska an den Holocaust erinnern und wie genau musste man sich das eigentlich vorstellen? Mir wurde während dieses Jahres erst so richtig klar, wie global und universalisiert die Erinnerung an den Holocaust im Jahr 2005 breits war, und dass wir die Entwicklung dahin nur verstehen können, wenn wir auf die internationalen oder transnationalen Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Wechselwirkungen schauen.

Was würdest du rückblickend jemandem raten, der heute ein Fulbright-Stipendium in den USA antritt?
Mein Rat an heutige Fulbright-Stipendiat*innen ist: Nutzt die Gelegenheit, euch intensiv mit neuen Perspektiven auf eure Studien- oder Forschungsthemen auseinanderzusetzen und knüpft so viele Kontakte wie möglich. Aber eben nicht nur an der Uni, sondern nutzt ebenso die Zeit, um Land und Leute kennenzulernen. Versucht, ein Gefühl für die Sichtweisen und Meinungen von Menschen zu bekommen, die mit eurer Lebensrealität nichts gemein haben. Für mich ist rückblickend – neben der Tatsache, dass ich komplett resistent gegen jegliche Form des Kulturschocks geworden bin – vielleicht der größte Gewinn, dass ich während meines Jahrs in Nebraska so richtig verstanden habe, wie das Heartland „tickt”.
Herzlichen Dank an Jacob Eder für das offene und reflektierte Gespräch sowie dafür, dass er seine Erfahrungen und Einsichten mit uns geteilt hat. Sein Weg zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltig ein Fulbright-Jahr wirken kann – nicht nur akademisch, sondern auch persönlich und kulturell.